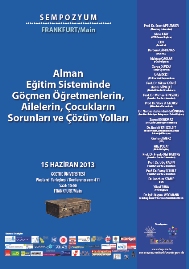|
Im internationalen wie im deutschen Kontext ist der Begriff der Hybridität vor allem durch die Arbeiten von Homi Bhabha in die Kultur- und Sozialwissenschaften eingeführt worden. Bhabha entwickelte seinen Hybriditätsansatz aus der Colonial Discourse Analysis heraus und verknüpfte seine Perspektive mit bestimmten gesellschaftspolitischen Implikationen. In dem Buch „Die Verortung der Kultur“ (Bhabha 2000) finden sich zwei Bedeutungs¬ebenen dieses Be¬griffes wieder: 1. Hybridität als eine Praxis der kulturellen Subversion im kolonialen Diskurs; 2. Hybridität als Bestandteil einer postkolonialen Kultur¬theorie. Mein Beitrag diskutiert am Beispiel des kanakischen Diskurses die Zusammenhänge zwischen Subversion und postkolonialer Kultur.
Die Geschichte der Migration in Deutschland ist nicht ohne die Geschichte rassistischer Diskurse in Politik, Medien sowie im Alltags¬leben zu denken. Zu sehr sind die deutschen Migrationserfahrungen auf beiden Seiten der inner¬gesell¬schaft-lichen Demarkationslinie, die zwischen Eingewanderten und (Volks)Deutschen unterscheidet, durch abwertende und ausgrenzende Meinungs¬mache in den letzten Jahrzehnten geprägt worden. Durch diskursive Praktiken wurde eine diskriminierende Politik unterstützt, die gesellschaftliche Hierarchien und sozio-kulturelle Ausschlüsse verfestigte. Paradoxerweise ist entgegen der rassistischen Logik dieses Diskurses auch noch etwas anderes, weniger vorhersagbares eingetreten: Durch Auseinander¬setzungen mit den aufgezwungenen Rassismus-erfahrungen und den dahinter¬stehenden Gesellschaftsverhältnissen, bei denen die Objekte der Weißen Diskurse sich zu Subjekten ihrer eigenen Geschichte erhoben, wurde eine Möglichkeit zur Reflexion und politischen Selbst-Ermächtigung gefunden. Der migrantische „Kanaken“-Diskurs, der durch Schriftsteller wie Osman Engin und Feridun Zaimoðlu in den 1990er Jahren zur populärkulturellen Ikone erhoben wurde, ist ein Beispiel für die Umkehrung dominant erscheinender kolonial-rassistischer Bilder durch Signifying Practices (Praktiken der Bedeutungsgebung) im Diskurs der Minderheiten. Gerade im literarischen Feld sind die Anfeindungen der Dominanzgesellschaft nicht ohne Widerrufe der Marginalisierten geblieben. Da die Migrations¬literatur und die dort vertretenen Stimmen kein homogenes Gebilde darstellen, ermöglichen sie in ihrer Vielfalt und gebrochenen Wahrnehmungen andere Perspektiven auf migrantische Zwischenwelten jenseits der vorherrschenden Klischees. Dabei verweist die selbst¬bewusste Aneig¬nung der Figur des „Kanaken“ als positiv gewendetes Selbstbild auf eine weit zurückreichende Geschichte der kolonial-rassistischen Missrepräsentation und auf Strategien postkolonialen Signifyings.
Koloniale Phantasmagorien im Migrationsdiskurs
Spätestens seit dem durch eine tiefgehende Strukturkrise der deutschen National¬ökonomie veranlassten Anwerbestopp für so genannte „Gast¬arbeiter“ wurden Anfang der 1970er Jahre die zuvor noch als nützlich erachteten Arbeitsmigrant/-innen zur sozio-kulturellen Problem¬gruppe erklärt und mit abwertenden Zuschreibungen bedacht. Zu dieser Zeit beschrieb der Schriftsteller John Berger den paradoxen Alltag türkischer Arbeiter in Westdeutschland:
„Seine Migration ist wie ein Ereignis in einem Traum, den ein anderer träumt. Die Intentionalität des Migranten ist durchdrungen von histo¬rischen Notwendigkeiten, deren sich weder er noch irgend jemand, den er trifft, bewußt ist. [...] Er verhielt sich zu den Lauten der unbekannten Sprache, als wären sie Schweigen. Als wären sie gesagt, um sein Schweigen zu brechen. Er lernte zwanzig Wörter der neuen Sprache. Aber zu seinem anfänglichen Erstaunen änderte sich ihre Bedeutung, wenn er sie sagte. Er bestellte Kaffee. Für den Barkeeper bedeuteten diese Worte, daß er in einer Bar Kaffee bestellte, in der er keinen Kaffee bestellen sollte. Er lernte ‚Mädchen‘. Als er das Wort gebrauchte, bedeutete es, daß er ein geiler Bock war. Ist es möglich, die Undurch-sichtigkeit der Wörter zu durchschauen?“ (Berger 1975 zit. nach Bhabha 1997: 187)
Um auf diese Frage näher einzugehen, ist es unverzichtbar den historischen und gesellschaftlichen Kontext herauszuarbeiten. Denn die mit dem Anwerbestopp einhergehende Verschärfung des negativen gesell¬schaft¬lichen Stimmungs¬bildes gegenüber migrantischen, besonders türkisch¬sprachigen Communities spiegelte sich beispielhaft in einer gro߬angelegten, von der gesamten Redaktion ausgearbeiteten Titel-Story eines deutschen Leitmediums wider. DER SPIEGEL, der bereits schon damals oft zu Unrecht den Ruf als linksliberales Flagschiff der deutschen Medien-landschaft genoss, verbreitete am 30.07.1973 unter dem unmissverständlichen Aufmacher „Die Türken kommen – rette sich wer kann“ eine Ansammlung von fiktiven Untergangsbildern und türkischen Negativstereotypen. Das Blatt bemühte sich sichtlich vor der „Überfremdung der deutschen Gesellschaft“ durch angeblich gefährliche „Ausländer“ zu warnen, die als „soziale Zeitbomben“ beschrieben wurden. Als Elemente des rassistischen Diskurses haben diffamierende Bilder und Katastrophenszenarien die Perspektive der deutschen Ausländer-Debatte auch im zeitlichen Längsschnitt mitbestimmt. Die inszenierte Politik- und Medienhysterie zur Abschaffung des Asyl-Grundrechts rekurrierte in den 1990 Jahren auf frappierend ähnliche Stilelemente und griff zudem auf alarmierende Bilder aus der deutschen Kolonialzeit zurück. Damals wurde in praktisch allen Medien vor der „Invasion der Asylanten“ oder dem vermeintlich anstehenden „Sturm auf Europa“ gewarnt. Auch Wie in den 1970er Jahren konstruierte DER SPIEGEL etwa unter der Schlagzeile „Gefährlich fremd“ (14.4.1997) rassistische Stereotypen und warnte in großformatigen Artikeln vor „Zeit¬bomben in den Vorstädten“.
Die bildhaften Analogie- und Kontinuitätselemente des Über¬frem¬dungs-diskurs sind erstaunlich beständig. Seit der imperialen Kaiser¬zeit werden gleichlautende Bedrohungs¬metaphern und Forderungen wieder¬holt. Schon vor dem Ersten Weltkrieg sind rassistisch stigmatisierte Migrant/-innen regelmäßig als Quelle der „Über¬fremdung“ und „Über¬schwemmung“ sowie als „Ströme“ und „Fluten“ identifiziert worden, und schon damals forderte man „Deutschland den Deutschen“. Die Wiederkehr kolonialer Metaphern und Bilder im Weißen Diskurs der deutschen Dominanzgesellschaft zeigt auf, dass weder die koloniale Geschichte Deutschlands ausreichend aufgearbeitet wurde, noch koloniale Denkmuster und die damit verbundenen Machtverhältnisse überwunden sind (Ha 2003a: 86-95).
Geschichten aus Kanakistan
Im Rahmen dieser diskursiven Entwicklung ist die seit den 1970er Jahren weitverbreitete Verwendung des Begriffs „Kanake“ als beleidigende Adressierung von Immigrierten, vor allem jenen mit türkischer Herkunft, in der Alltagswelt und der Jugendkultur zu situieren. Die Bezeichnung „Kanake“ entstand vermutlich im Laufe des 19. Jahrhunderts, als der in Deutschland tiefverwurzelte Anti-Slawismus gegenüber „Kosaken“, „Hannaken“ und „Polacken“ sich mit dem seit der deutschen Kolonialexpansion in den pazifischen Raum gepflegten Mythos des „Kann¬nibalen“ zu einem kolonial-rassistischen Neologismus verband (Gerhard/Link 1991: 147). In diesem Sinne fungiert dieser Terminus bis heute als volkstümliche Chiffre für den biologisch und zivilisatorisch minderwertigen Anderen. Im neorassistischen Alltagsdeutsch verfügen auch andere erniedrigende Bezeichnungen wie „Bimbo“, „Neger“ und „Fidschi“ über eine ähnliche kolonial-rassistische Aufladung.
Als Feridun Zaimoðlus „Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft“ 1995 im kleinen Rotbuch Verlag erschien, wurde es zunächst kaum wahrgenommen. Nicht nur die literarische Sprachform war für die deutsche Kulturlandschaft zunächst zu neuartig und gewöhnungsbedürftig, ebenso waren die Perspektiven und Lebenswelten der Zweiten Generation der Eingewanderten bis dato kein Thema, das Anerkennung und Relevanz in diesen Sphären beanspruchen konnte. Neben anfänglichem Desinteresse schreckte der deutsche Medien- und Kulturbetrieb auch vor zwei grundlegenden Prämissen in „Kanak Sprak“ zurück: 1. Die „‚Gastarbeiter¬kinder‘ der zweiten und vor allem der dritten Generation [bezeichnen sich selbst] mit stolzem Trotz“ (Zaimoðlu 1995: 9) wahlweise als „Kanake, Kanaksta oder Kanakgangsta“. 2. In diesem Buch hat „allein der Kanake das Wort“ (ebd.: 18), der in Unterschied zum „sozial verträglichen“ (ebd.) akademischen Gelehrten mit kosmo¬politischem Flair eine Form des Straßenkampf-erprobten Intellektuellen markiert. Diese kulturpolitische Selbststilisierung und Positionierung, die sich ausdrücklich von der „weinerliche[n], sich anbiedernde[n] und öffentlich geförderte[n] Gastarbeiter¬literatur“ (ebd.: 11) abwandte, passte nicht so recht in den Bildungshorizont des deutschen Bürgertums. Mit dem Rückzug der Alt-68er, von denen etliche mit zunehmender gesellschaftlicher Etablierung sich ideologisch nach rechts wendeten, war Antonio Gramscis Ideal des politisch engagierten organischen Intellektuellen, der für die Unterdrückten und Ausgebeuteten agitiert (Said 1998: 9-50), im deutschen Kultur- und Universitätsleben zudem eine selten anzutreffende Spezies.
Entgegen der Vermarktung von „Kanak Sprak“ als „wilde und radikal-authentische Bekenntnisse junger Männer türkischer Abstammung“ (Cover) stellt dieses sprachlich innovative Werk eine höchst stilisierte und literarisch kunstvoll komponierte Anthologie mittels „Übersetzung“ und „Nachdichtung“ (Zaimoðlu 1995: 18) dar. Die verdichteten und dramaturgisch überarbeiteten Texte basierten auf Interviews mit unterschiedlichen männlichen Mitgliedern der Zweiten Generation: von Rappern, Fundamentalisten, Soziologen über KFZ-Mechaniker bis zum Zuhälter, Stricher und Transsexuellen. Als Reportagen „aus dem Kosmos von Kanakistan, einem unbekannten Landstrich am Rande der deutschen Gesellschaft“ (Cover), sollen sie der Leserschaft Einblicke in „ihr Dasein und ihre Lebensphilosophie“ (innerer Schutz¬umschlag) gewähren. In diesem Sinne lässt sich dieses Buch als eine literarische Version einer fiktionalisierten urbanen Sozio-Ethnografie in der ersten Person Singular lesen, die im Gegensatz zur wissenschaftlichen Arbeit kreative Freiheiten in Anspruch nehmen darf.
„Der direkte Draht zum schwarzen Mann“
Zweifellos ist die subkulturelle Umkehrung der ursprünglich rassistisch kontextuali¬sierten Redewendung „Kanake“ Teil der deutsch-türkischen Migrations-erfahrung. Gerade in der migrantischen HipHop-Kultur sind auf allen Ebenen jedoch vielfältige Verbindungen zum Schwarzen Amerika unübersehbar. Die Anleihen gerade in den Anfängen sind so massiv, dass Ali, ein Rapper von Da Crime Posse, sein kulturelles Kapital als „direkten Draht zum schwarzen Mann“ (Zaimoðlu 1995: 27) bezeichnet. Zaimoðlu verstand zu dieser Zeit „Kanak Sprak“ als „Untergrund-Kodex [...] eine Art Creol oder Rotwelsch mit geheimen Codes und Zeichen. Ihr Reden ist dem Free-Style-Sermon im Rap verwandt“ (ebd.: 13). Sein Vorbild sind die afroamerikanischen Hardcore-Polit-Rapper von Public Enemy, die Rap als „Black CNN“ ansehen. In seiner Einleitung zu „Kanak Sprak“ zieht Zaimoðlu folgende Verbindung:
„Sie alle eint das Gefühl, ‚in der liga der verdammten zu spielen‘, gegen kultur-hegemoniale Ansprüche bestehen zu müssen. Noch ist das tragende Element dieser Community ein negatives Selbstbewußtsein, wie es in der scheinbaren Selbstbezichtigung seinen oberflächlichen Ausdruck findet: Kanake! Dieses verunglimpfende Hetzwort wird zum identitässtiftenden Kennwort, zur verbindenden Klammer dieser ‚Lumpenethnier‘. Analog zur Black-Consciousness-Bewegung in den USA werden sich die einzelnen Kanak-Subidentitäten zunehmender übergreifender Zusam¬men¬hänge und Inhalte bewußt“ (ebd.: 17).
Es ist tatsächlich naheliegend, die Umdeutung des „Kanaken“ äquivalent zur Aneignung des kolonial-rassistischen „Niggers“ im afroamerika¬nischen Rap und der Schwarzen Alltagssprache zu sehen. Schwarze Kultur- und Musikkritiker/-innen haben anhand von Rap-Lyrik, Rhyth¬mus und Präsentationsformen aufgezeigt, wie sie die Existenz von Auto¬ren¬schaft an¬zweifeln und damit Authentizität und Essentialismus in Frage stellen. Rap ver¬sucht mehr¬deutige Bedeutungen zu schaffen und damit Homogenität und Ein¬deu¬tigkeit zu konterkarieren. Rapper/-innen machen sich gerne über den Vorwurf des gei¬sti¬gen Diebstahls durch Sampling lustig und nutzen teilweise das Medium der Musik¬videos statt als Werbung oder Ware auch für politische Agitationen und kri¬ti¬sche Geschichtsaufarbeitungen.
Stuart Hall beschreibt in seinem Buch „Cultural Representations and Signifying Practices“ den Prozess des trans-coding, der neue instabile und gegensätzliche Bedeutungen zu den bestehenden Möglichkeiten der Sinngebung offeriert:
„Ultimately, meaning begins to slip and slide; it begins to drift, or be wrenched, or inflected into new directions. New meanings are grafted on to old ones. Words and images carry connotations over which no one has complete control, and these marginal or submerged meanings come to the surface, allowing different meanings to be constructed, different things to be shown and said“ (Hall 1997c: 270).
Die politische Logik der kulturellen Praxis der Verschiebung und Neuaneignung ist theoretisch nur dann verständlich, wenn wir sie in einem transnationalen und postkolonialen Rahmen situieren. Auch andere anti-rassistischen Ansätze operieren mit einer hybridisierten Identitätspolitik der Selbst-Kanakisierung, die über historische Vorläufer verfügt. So weist eine Reihe historischer Entwicklungen darauf hin, dass das umkämpfte Terrain der Identität nicht nur das Ziel, sondern auch die gemein¬same Ausgangsbasis für politischen Aktivismus von People of Color darstellt. Durch anti-rassistische und anti-koloniale Entwicklungen wie die Civil Rights-Bewegung und die Black Power Movement konnte in den USA der 1960er Jahre erstmals massenhaft ein positiver Bezug zur Schwarzen Identität gebildet werden. Angetrieben durch Slogans wie „Black is beautiful“ und „I’m black and I’m proud“ diente die Identitätsmarkierung Schwarz-Sein (Blackness) durch die selbst¬bewusste Brechung der inferiorisierten Subjekte nicht mehr länger wie in der bis dahin vorherrschenden kulturellen Tradition des Rassismus als negatives Symbol. Dieser politische Bewusstwerdungsprozess wurde durch ein populärkulturelles Umfeld verstärkt, das sich aktiv an der Um- und Aufwertung von Blackness beteiligte. Die identitätspolitische Selbstaneignung wurde als gesellschaftlich trans¬formierende Kraft sowohl für die Schwarze Diaspora in Europa als auch für andere kolonialisierte Communities von People of Color bedeutsam.
Postkoloniales Signifying
Es war wohl kein Zufall, dass die indigenen Bewohner/-innen der französischen Überseekolonie Neukaledonien ausgerechnet in den rebel¬li¬schen 1970er Jahren begannen, die historisch abwertende Kolonial¬bezeichnung „Kanak“ im Rahmen einer kulturellen Strategie des Self-Empowerment zu übernehmen. Stand diese Identitäts-position bis zu diesem Zeitpunkt für ein durch Weiße „Blackbirders“ (europäische Menschenjäger) und Kolonialadministration auf¬gezwungenes Trauma der Deportation und Zwangsarbeit, so verkehrten sich mit ihrer aktivistischen Neusetzung auch ihre politischen und gesell¬schaftlichen Funk¬tionen. Aus kolonialen Objekten wurden durch Prozesse der Selbst¬aneignung postkoloniale Subjekte, die selbstbewusst für die unabhängige Entwicklung ihrer Gesellschaft jenseits des Eurozentrismus kämpften und auf diese Weise versuchten, ihre Geschichte neu zu schreiben (Valjavec 1995: 38, 62).
In der Geschichte kanakischer Identitätskonstruktionen vermischt sich die Globalisierungsgeschichte der Kolonialisierung mit den Ge¬schich¬ten widerständiger Selbstinszenierungen. Es ist diese uneindeutige Doppelbewegung in der historischen Dynamik von identitätspolitischen Fremd- und Selbstzuschreibungen, wodurch Benennungen sowohl als Praktiken der kolonial-rassistischen Herrschaft als auch der Selbst-Ermächtigung fungieren können. Wie Homi Bhabha in seiner Analyse des Kolonialdiskurses herausgestellt hat, machen sich Mimikry und Hybridisierung – oder stark vereinfacht ausgedrückt kulturelle Nach¬ahmung und Vermischung – als Widerstandsstrategien die Ambivalenz kolonialer Diskurse zunutze. Obwohl kolonial-rassistische Autoritäten durch territoriale Aufteilungen, gesellschaftliche Herrschafts¬anord¬nungen und Rassenerfindungen faktisch neue soziale, kulturelle und biopolitische Grenzen etablierten, wirkten sich viele dieser Praktiken auf der anderen Seite als Entgrenzung von Räumen und Identitäten auch zwiespältig aus. So entstand mit der Durchsetzung kolonialer Beziehungen ein voneinander abhängiges Referenz-system von Bedeutungszuweisungen und gesellschaftlichen Hierarchien, in dem die aufeinander verweisenden Fremd- und Selbstbilder eine ungleiche Beziehung eingingen: Europa und „seine“ Anderen, Whiteness und Blackness, Zentrum und Peripherie, nationale Dominanzkultur und „Minderheiten“, Deutsche und „Ausländer“.
In diesen Identitätsbildern und Privilegienverteilungen kommt eine gesellschaftliche Konfiguration zum Ausdruck, die sich einerseits durch Machtartikulation und polare Setzung formiert; andererseits auch von einer unvermeidlichen Einbeziehung des Anderen abhängt. Erst durch die Konstruktion des unterlegenen Anderen war es überhaupt möglich, dominante und marginale Positionen gesellschaftlich zu produzieren. In der rassistischen Identitätspolitik kommt daher die europäische Definitionsmacht zur Sprache, die durch Weiße Phantasmagorien und Bedürfnisse ins Leben gerufen wurde. Für den Rassismus ist es konstitutiv, dass er in einem gegensätzlichen Verhältnis von Abspaltung und Identifikation zum Anderen steht. Daher gehen gewalttätige Diskurse der Vernichtung und Eindämmung immer mit Vereinigungswünschen und Projektionen Hand in Hand – etwa über den „guten Wilden“ oder die „arme Migrantin“, die man retten muss.
Aus dieser widersprüchlichen Funktionsweise des Rassismus ergibt sich, dass die kolonial-rassistische Ausgrenzung wie die damit einher¬gehende Kontrollmacht niemals total sein können. Das bedeutet auch, dass marginalisierte Subjekte handlungsmächtig sind und die Möglichkeit haben dominante Narrationen diskursiv zu unterbrechen. Dadurch ist in der gewaltvollen Dynamik der kolonialen Moderne ein Prozess in Gang gekommen, der als hybride Praxis der Grenzüberschreitung in Erscheinung tritt. Diese vieldeutige Praxis ist mit einer Verdoppelung und Fragmentierung von Identitäten verbunden, in der die koloniale Autorität mit ihrem unterdrückten Doppelgänger auf der anderen Seite der Geschichte konfrontiert wird. Diese umkämpfte und niemals eindeutige Identität können wir mit dem afroamerikanischen Soziologen W.E.B. DuBois (2003) als eine Form des double consciousness bezeichnen. Kanakische Identität speist sich aus diesem grenz¬wertigen Bewusstsein, weil es einerseits um die kolonialisierende Wirkung seiner Benennungen weiß und andererseits gerade aus dieser intimen Einsicht heraus die Notwendigkeit erkennt, kolonial-rassistische Modelle durch Mimikry und Hybridi¬sierung zu verunreinigen und zu verunsichern (Ha 2004: 128-152).
Kanakische Identitätspolitik als Widerstandsperspektive versucht sich der Macht der Kolonialsprache zu entziehen, indem die Kolonialisierten in Sprechakten sich selbst definieren und damit diskursiv aus ihrem Objektstatus heraustreten. Widerstand wird nicht erst dann praktiziert, wenn explizit Gegenmodelle vertreten werden. Je nach dem wie die gesellschaftlichen Kräftekonstellationen aussehen, welche strategischen Optionen wirkungsvoll erscheinen und welche kulturellen Praktiken zur Verfügung stehen, können Kolonialisierte sich auch tarnen und die koloniale Anrufung durch Prakti¬ken der Selbstbenennung umkehren. Solche hybriden identitäts¬politischen Interventionen reflektieren und überschreiten zugleich die kolonialen Einschreibungen in Geschichte und Gegenwart. Auf Eindeutigkeit basierende rassistische Identitätsmodelle können durch verwirrende Störungen, Bedeutungsverschiebungen und Über¬schreibungen in Zweifel gezogen, evtl. sogar dekolonialisiert werden. Indem diese subalternen Subjekte die Mittel ihrer Unter-drückung und Abwertung der kolonialen Autorität entwenden, verwandeln sich diese herr¬schaftlichen Zeichen europäischer Definitionsmacht in identitäts¬politische Instrumente des Selbst-Empowerments.
Referenzen:
Bhabha, Homi (1997): „DissemiNation. Zeit, Narrative und die Ränder der modernen Nation“. In: Bronfen, Elisabeth/Marius, Benjamin/Steffen, Therese (Hg.): Hybride Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismus debatte. Tübingen: Stauffenburg, S. 149-194.
Ha, Kien Nghi (2003): „Die kolonialen Muster deutscher Arbeitsmigrationspolitik“. In: Gutiérrez Rodríguez, Encarnación/Steyerl, Hito (Hg.) (2003): Spricht die Subalterne deutsch? Postkoloniale Kritik und Migration. Münster: Unrast, S. 56-107.
Ha, Kien Nghi (2010): Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Hybridität und der kolonialen „Rassenbastarde“. Bielefeld: transcript.
Hall, Stuart (1997): Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage
Zaimoðlu, Feridun (1995): Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. Hamburg: Rotbuch.
|