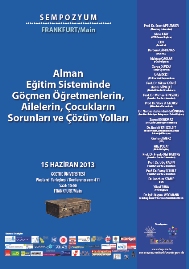Einigermaßen klar ist z. B.: Migrantenkinder zeigen häufig Entwicklungsrückstände in ihrer ersten Sprache. Und: Migrantenkinder zeigen häufig Entwicklungsrückstände in ihrer zweiten Sprache. Signifikante Zusammenhänge überraschen da nicht wirklich. Man muss aber weiter ergänzen: Migrantenkinder kommen häufig aus armen, bildungsfernen Familien. Und: Schlechte Schüler kommen häufig aus armen, bildungsfernen Familien. Damit gilt: Die derzeit von der Bilingualismusforschung vorgelegten Befunde sind also zwar (noch) kompatibel mit der Schwellenhypothese. Aber auch die Armutshypothese erklärt das Bild ziemlich anschaulich. Was, wenn nicht die Bilingualität, sondern die Armut entscheidend ist?
Wenn man Bücher oder Zeitschriftenartikel über Zweisprachigkeit liest, dann dauert es nicht lange, bis man auf die Schwellenhypothese stößt. Sie stammt von Cummins und behauptet eine besondere Beziehung zwischen erster und zweiter Sprache. Die Schwellenhypothese besagt: Es gibt einen besonderen Zusammenhang zwischen erster und zweiter Sprache, eine Interdependenz, also eine gegenseitige Abhängigkeit. Meint: Wenn Kinder in ihrer ersten Sprache gut sind, dann gibt es in der zweiten Sprache meistens auch keine Probleme. Und sie meint auch: Wenn es in der ersten Sprache schlecht läuft, dann sind auch in der zweiten Sprache Schwierigkeiten zu erwarten. Hört sich einsichtig an. Ist aber möglicherweise falsch.
Bilingualität ist eine gute Sache, bilinguale Schulen sind eine gute Sache. Wissenschaftliche Ansätze, die bilinguale Unterrichtskonzeptionen untersuchen, sind eine gute Sache. Und dennoch ist es sinnvoll, auch lieb gewonnene Hypothesen gelegentlich kritisch zu überprüfen. Die Beweisführung der meisten Kollegen in Sachen Schwellenhypothese sieht in etwa so aus: Man untersucht zunächst die Sprachentwicklung in der ersten Sprache. Dann untersucht man die Sprachentwicklung in der zweiten Sprache. Und wenn man einen Zusammenhang entdeckt, also wenn Kinder z. B. in der ersten Sprache einen großen Wortschatz haben und der Wortschatz in der zweiten Sprache ebenfalls groß ausfällt, dann glauben einige Forscher einen Beleg für die Gültigkeit der Schwellenhypothese gefunden zu haben. Oder Forscher untersuchen die Lernentwicklung von Kindern in bilingualen Schulen und stellen fest: Die untersuchten Kinder entwickeln sich gut – in ihrer ersten Sprache und in ihrer zweiten Sprache. Sieht so ein Beleg für die Schwellenhypothese aus?
Die Falsifikation, also die Widerlegung von Hypothesen ist in der Regel einfach. Solche Versuche sind auch sinnvoll. Denn die Falsifizierbarkeit - so muss man zumindest mit Karl Popper, einem der wichtigsten Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts, festhalten – macht den Kern wissenschaftlicher Ansätze aus. Zugegeben, die Gedankenwelt von Wissenschaftstheoretikern ist ein wenig kompliziert. Beweise im strengen Sinne sind nach Analyse Poppers nicht möglich. Man kann aber versuchen, einen Ansatz zu widerlegen. Scheitern solche Falsifikationsversuche spricht das für einen Ansatz. Gelingen Falsifikationsversuche, spricht das gegen einen Ansatz. Ansätze, bei denen Falsifikationsversuche nicht möglich sind, sind dagegen nicht wissenschaftlich.
Wie kann also eine solche Falsifikation bei der Schwellenhypothese aussehen? Es sind Kinder, die in der ersten Sprache große Schwächen haben, in der zweiten Sprache aber eine gute Entwicklung hinlegen, die die Schwellenhypothese in Schwierigkeiten bringen. Kennen Sie solche Kinder? Kinder, z.B. ihre erste Sprache, Türkisch nicht gut sprechen, aber deren Deutsch wirklich makellos ist? Wie ist das mit bilingualen Kindern an deutschen Gymnasien. Sind da nicht zumindest einige Schüler dabei, deren Leistungen in der ersten Sprache nicht einmal durchschnittlich sind? Und haben wirklich alle bilingualen Studenten immer auch gute Kenntnisse in ihrer ersten Sprache?
Eine kleine Studie an der Evangelischen Fachhochschule Bochum sucht nun systematisch nach diesen Schülern: schlechte Sprachkenntnisse in der ersten Sprache – gute oder zumindest durchschnittliche Leistungen in der zweiten Sprache. Es handelt sich um eine Längsschnittstudie, also eine Untersuchung, in der wir die Kinder über einen Zeitraum von etwa drei Jahren begleiten. Wir interessieren uns für den Wortschatz in der Kita, für die Rechtschreibentwicklung und für das Lesen in der Schule. Das sind (noch) nicht viele Kinder. In deutscher Sprache liegen uns Ergebnisse aus 71 Testungen vor, in deutscher und russischer Sprache sind es Ergebnisse aus 38 Testungen. Wir haben uns in zwei Städten des Ruhrgebiets Kindertageseinrichtungen ausgesucht, die von möglichst hohen Anteilen russisch-deutschsprachiger Kinder besucht werden, einfach deshalb, um nicht zu viel Arbeit zu haben. Ja, es wäre besser gewesen, wenn wir die Regeln eingehalten hätten, mit denen man Repräsentativität herstellt. Haben wir nicht, noch nicht. Ist eine Pilotstudie, also eine erste Erkundung in diesem Feld. Und wir haben bislang nur eine russische Übersetzung des Wortschatztests. Aber die Rechtschreibentwicklung der ersten im Jahr 2012 eingeschulten Kinder lässt sich nun absehen. Die Befunde sind ziemlich aufregend. Deshalb kommt hier ein erster Bericht.
Die Ergebnisse aus der Kita: Die Wortschatztests sind wirklich schlecht ausgefallen. Es gibt eine Mehrheit von Kindern mit schlechten Wortschatzkenntnissen. In deutscher Sprache erreichen 24 Kinder weit unterdurchschnittliche Werte (T-Wert < 30). Auf durchschnittliche Werte kommen 21 Kinder (T-Wert 40-60). Überdurchschnittliche Werte erreicht keines der untersuchten Kinder. Und die Probleme beschränkten sich keineswegs auf die zweite Sprache. In russischer Sprache haben 23 Kinder weit unterdurchnittliche Wortschatzkenntnisse. Nur sechs erreichen durchschnittliche Kenntnisse in ihrer ersten Sprache. Auch in der ersten Sprache finden sich keine Kinder mit überdurchschnittlichem Wortschatz. Für etwa ein Drittel der Kinder gilt also: Können nicht gut deutsch sprechen und beherrschen auch nicht ihre Muttersprache. Doppelte Halbsprachigkeit nennt sich das.
Insgesamt sind im Schuljahr 2012/13 vierzehn dieser Kinder eingeschult worden. Für sieben Kinder liegen uns Wortschatztests in erster und zweiter Sprache vor. Die Ergebnisse aus der Schule: Acht der 14 Erstklässler zeigen eine durchschnittliche Rechtschreibentwicklung, zwei kommen sogar auf überdurchschnittliche Werte. Das ist also gar nicht schlecht. Noch interessanter werden die Befunde, wenn man die sieben bilingual russisch-deutschsprachigen Kinder betrachtet. Im Schuljahr 2013/14 starteten alle von uns untersuchten Kinder mit einem weit unterdurchnittlichen Wortschatz ihrer Muttersprache. Aber vier von diesen sieben Kindern zeigen nach nicht einmal acht Monaten Unterricht auf durchschnittliche Rechtschreibleistungen, ein Kind kommt sogar auf überdurchschnittliche Werte.
Was bedeuten diese ersten Befunde unserer Pilotstudie? Unsere Untersuchung zeigt zunächst vergleichsweise wenig überraschende Ergebnisse. Es gibt in deutschen Kitas viele Migrantenkinder mit Wortschatzproblemen. Die Probleme betreffen die erste und die zweite Sprache. So auch in der Bochumer Wortschatzstudie. In dieser Untersuchung ändert sich aber das Bild nach der Einschulung – und zwar ziemlich drastisch. Weit unterdurchschnittliche Rechtschreibleistungen zeigt nur ein Kind von 14 Kindern. Die untersuchten Kinder konnten also mehrheitlich mit gutem Erfolg alphabetisiert werden. Und dies gilt offenbar auch für Kinder, die nicht nur in ihrer ersten, sondern auch in ihren zweiten Sprache mit erheblichen Wortschatzproblemen eingeschult wurden. Es gibt zudem nicht nur einige wenige Kinder, die trotz Problemen in ihrer ersten Sprache zumindest durchschnittliche Ergebnisse in ihrer Rechtschreibentwicklung zeigen. Sondern in unserer Studie trifft dieses sogar auf die Mehrheit der Kinder des Schuljahrs 2012/2013 zu.
Nüchtern betrachtet ist bereits mit den Befunden dieser kleinen Studie die Schwellenhypothese in arge Schwierigkeiten geraten. Entsprechende Befunde hätten so ausgesehen: Schlechter Wortschatz – schlechte Leistungen in der Schule, und zwar eigentlich für alle Kinder. Hier zeigt sich aber ein anderes Bild: Schlechter Wortschatz in der ersten Sprache – schlechter Wortschatz in der zweiten Sprache – zumindest durchschnittliche Rechtschreibentwicklung in der Schule. Man könnte diese Befunde als seltene Ausnahmeerscheinung betrachten, als Folge genialer Sprachförderung in den Schulen z. B. oder als seltenen Hinweis auf Resilienz. Aber: Die hier vorgestellte Studie ist nicht die erste Untersuchung, die zu solch irritierenden Befunden kommt. Dass Kinder trotz schlechter Kenntnisse in der ersten Sprache gute Kenntnisse in der zweiten Sprache entwickeln können, haben z. B. auch die Bilingualismusforscher Silven und Rubinov bereits im Jahr 2010 feststellen können. Und man muss darüber hinaus festhalten: Es gibt bislang nicht allzu viele Falsifikationsversuche in Sachen Schwellenhypothese.
Die Forschung hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich mit anderen Dingen befasst. Einigermaßen klar ist z. B.: Migrantenkinder zeigen häufig Entwicklungsrückstände in ihrer ersten Sprache. Und: Migrantenkinder zeigen häufig Entwicklungsrückstände in ihrer zweiten Sprache. Signifikante Zusammenhänge überraschen da nicht wirklich. Man muss aber weiter ergänzen: Migrantenkinder kommen häufig aus armen, bildungsfernen Familien. Und: Schlechte Schüler kommen häufig aus armen, bildungsfernen Familien. Damit gilt: Die derzeit von der Bilingualismusforschung vorgelegten Befunde sind also zwar (noch) kompatibel mit der Schwellenhypothese. Aber auch die Armutshypothese erklärt das Bild ziemlich anschaulich. Was, wenn nicht die Bilingualität, sondern die Armut entscheidend ist?
Wenn sich der Befund bestätigen lassen sollte, dass desolate muttersprachliche Kenntnisse keineswegs zwingend eine gute Lernentwicklung in der Mehrheitssprache ausschließen, dann ist dies zwar sicher eine schlechte Nachricht für Anhänger der Schwellenhypothese. Aber dies ist keine schlechte Nachricht für Schulen, die bilinguale Schüler haben und keine oder nur unzureichende bilingualen Angebote machen können. Hatte man bislang vielleicht sogar einigen Anlass für fatalistische Gedanken bei Kindern mit schlechten Erstsprachkenntnissen, so deutet sich nun an: Es lohnt sich für diese Kinder zu kämpfen, und zwar auch dann, wenn keine ausreichenden Mittel für bilinguale Förderprogramme zur Verfügung stehen. Wer in der ersten Sprache nur dürftige Fortschritte macht, für den muss die zweite Sprache keineswegs zwingend dauerhaft verschlossen bleiben.
|